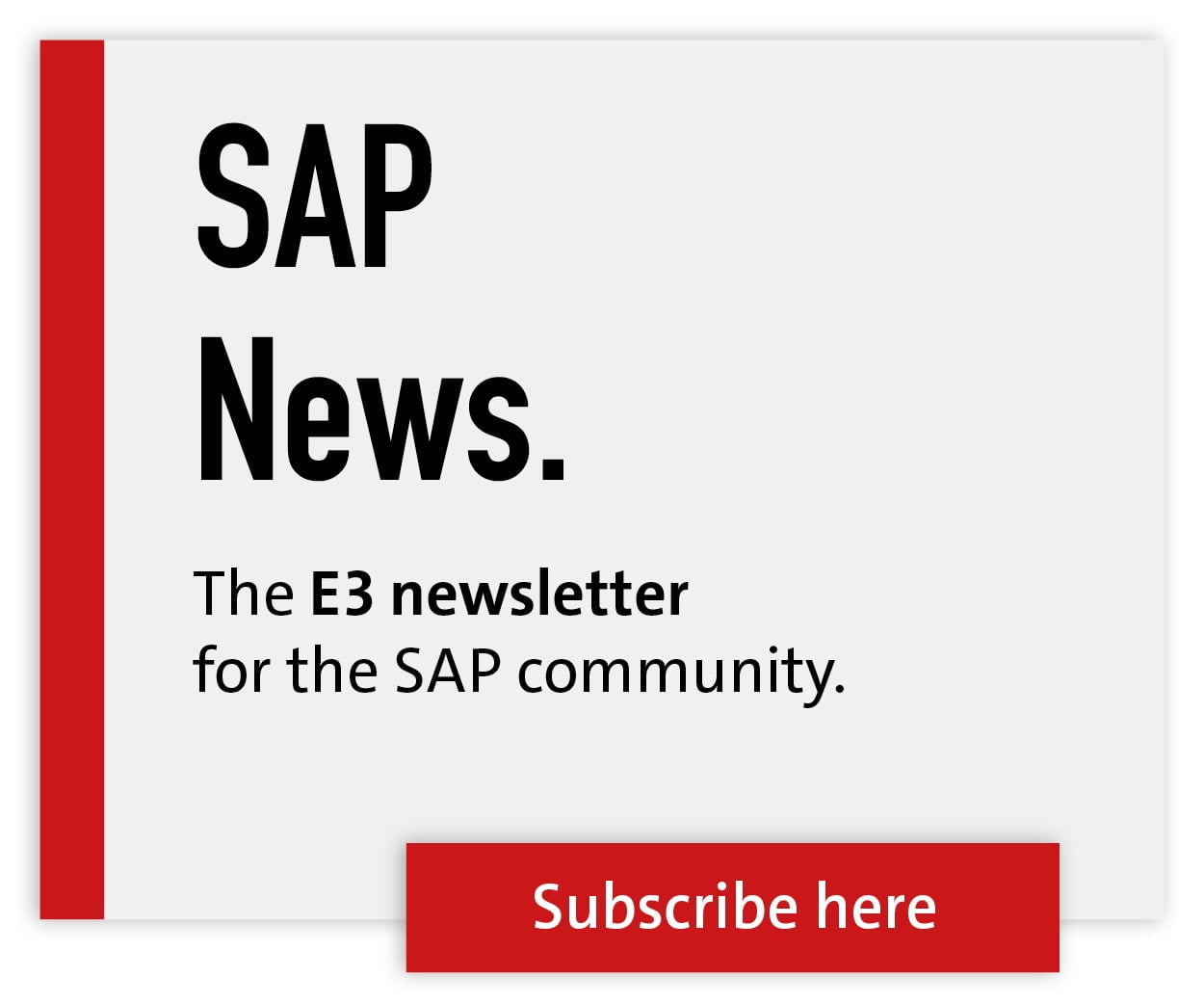Königsweg zum Golden Record


Was sind die Erfolgsfaktoren für eine Stammdateninitiative?
Marco Wittigayer: Eine Stammdatenmanagementinitiative ist kein in erster Linie technologisches und daher auch kein reines IT-Thema. Sie muss in Unternehmen gemeinsam von den Fachbereichen und von der IT getrieben werden.
Laut einer PwC-Studie gehören unter anderem die Unterstützung durch das Management, strukturierte und zielgerichtete Data Governance sowie Prozessoptimierung zu den Erfolgsfaktoren.
Sie sollten nicht irgendwo im Unternehmen angesiedelt sein, sondern beim Top-Management. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Bedeutung hoher Stammdatenqualität für die Geschäfts- und Kostenentwicklung von allen Mitarbeitern verstanden wird.
Unternehmensinterne Richtlinien für den Umgang mit Daten sind zwingend erforderlich. Die Data Governance definiert einheitliche Regeln, Prozesse und Verantwortlichkeiten für Dateneingabe, -freigabe und -pflege sowie Datenqualitäts-KPIs.
Dabei sind nicht nur die Kernprozesse im Unternehmen zu berücksichtigen, wie Einkauf, Produktion oder Vertrieb. Auch die Stammdatenprozesse rund um das Anlegen, Pflegen oder Löschen von Daten müssen optimiert werden.
 Ist dafür viel Überzeugungsarbeit bei den Mitarbeitern notwendig?
Ist dafür viel Überzeugungsarbeit bei den Mitarbeitern notwendig?
Wittigayer: Eine Stammdateninitiative greift in überkommene Strukturen, Prozesse und Hoheitsgebiete ein.
Daher gehört ein begleitendes Change Management zu den Erfolgsfaktoren, um die Betroffenen zu Beteiligten zu machen und sie in die neue Welt „mitzunehmen“.
Eine professionelle Softwarelösung schließlich kann stets nur unterstützend wirken. Erst nachdem Prozesse und Befugnisse für die Datenpflege und -freigabe klar definiert sind, kann eine IT-Unterstützung erfolgen.
Wie sollten Unternehmen bei einer Stammdateninitiative vorgehen?
Wittigayer: Wir empfehlen, nicht gleich mit allen Stammdatendomänen – Kunden, Lieferanten, Material, Produkte, Finanzen etc. – zu starten, sondern erst einmal nur mit einer Domäne.
Für die Auswahl gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Man kann die Domäne mit den größten Qualitätsproblemen zuerst angehen oder die, die entweder die größte Bedeutung für das Unternehmen besitzt oder die schnellsten Erfolgserlebnisse verspricht. Das ist eine individuelle Entscheidung.
Nach dem Start mit einer Domäne erfolgt der Ausbau der Stammdateninitiative auf die weiteren Domänen, also z.B. erst die Kundenstammdaten, dann die Lieferantenstammdaten usw. So ergibt sich eine durchaus sinnvolle Aufteilung des Gesamtprojekts auf mehrere Phasen.
Welche MDM-Lösung ist aus Ihrer Sicht wirkungsvoller: Single- oder Multi-Domain?
Wittigayer: Unabhängig von unserer Empfehlung, zunächst mit einer Domäne zu starten, sollten Unternehmen eine Multi-Domain-MDM-Lösung einsetzen.
Dabei handelt es sich um eine Stammdaten-Lösung, die mehrere Stammdatendomänen abdeckt und das gesamte Master Data Management in einer Plattform zentralisiert. Alle relevanten Daten vom Einkauf bis zum Verkauf laufen in einem zentralen System zusammen und können von dort an beliebige Zielsysteme verteilt werden.
Das eröffnet neue Perspektiven für den Geschäftsprozess. Unternehmensweite Zusammenhänge und Wechselwirkungen werden sichtbar – und damit nicht selten ein beträchtliches Einsparpotenzial bei Zeit und Kosten.
Bringt man zugehörige Stammdaten einer Domäne zusammen, lässt sich ein „Golden Record“ für beispielsweise Kunden, Produkte, Lieferanten bilden und lassen sich Wechselwirkungen zwischen diesen Domänen erkennen. Man erhält einen Rundumblick auf die Stammdaten über alle Domänen hinweg.
Ein Multi-Domain-MDM schafft somit die „eine Wahrheit“ für unterschiedliche Stammdatendomänen über den gesamten Geschäftsprozess.
Welche Vorteile bieten Multi-Domain-Lösungen noch?
Wittigayer: Neben der integrierten unternehmensweiten Datenhaltung können Multi-Domain-MDM-Systeme mit Datenqualitätsregeln und Lebenszyklusprozessen auch Data Governance unterstützen, also einheitliche und verbindliche Rahmenbedingungen, Workflows und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit Daten, ihre Pflege, Verteilung etc. Bei der Nutzung von diversen Single-Domain-Datensilos ist es naturgemäß schwierig, die unternehmensweite Einhaltung definierter Standards sicherzustellen.
Gibt es dagegen nur eine Quelle für Stammdaten, haben die Nutzer erheblich weniger Autonomie bei der Entwicklung von Definitionen und Regeln für Daten, da die domänenübergreifende Datenarchitektur verbindlich und transparent ist.
Das Ergebnis: wirksame Governance-Prinzipien und funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Abteilungen. Beides zusammen führt zu mehr Prozesseffizienz und besserer Ressourcenallokation.
Wie ist Ihre Vorgehensweise bei einem Stammdatenprojekt?
Wittigayer: Wir gehen in fünf Schritten vor, wobei jede Phase mit einem Meilenstein abgeschlossen wird, bevor die nächste Projektphase beginnt.
Innerhalb der Projektvorbereitungsphase wird in Abstimmung mit dem Kunden der Projektumfang spezifiziert und ein detaillierter Projektplan erstellt. Ein Kick-off-Meeting inklusive Teamtraining holt alle Beteiligten ins Boot.
In der anschließenden Sollkonzept-Phase, die den Grundstein für den Erfolg eines Stammdatenprojekts legt und somit die wichtigste Phase darstellt, definieren wir in Workshops und Gesprächen individuelle Zielsetzungen; zudem erarbeiten wir ein bedarfsgerechtes Konzept für die IT-gestützte Abbildung der unternehmensspezifischen Data-Governance-Aspekte, Berechtigungen und die damit verbundenen Prozesse.
Auch die Definition der Datenmodelle sowie der Schnittstellen (Datentransfers) erfolgt in dieser Phase. Die Entscheidung, welche Stammdaten im zentralen System geführt werden sollen, ist ebenfalls Bestandteil dieser Phase.
Parallel dazu installieren wir ZetVisions SPoT auf der Systemlandschaft des Kunden.
Was passiert nach dieser Phase?
Wittigayer: In der darauf folgenden Implementierungsphase werden die einzelnen Fachkonzepte in die Tat umgesetzt. Gegebenenfalls bereiten wir hier auch eine initiale Datenübernahme in SPoT vor.
Weiterhin erhalten Kunden nun die Gelegenheit, die Einstellungen oder Anpassungen des neuen Systems ausgiebig zu testen.
Während der Produktionsvorbereitung unterstützt ZetVisions den Kunden bei der Go-live-Planung. Dazu gehört selbstverständlich auch die Schulung der Mitarbeiter. Sie sollen das System nicht nur handhaben können, sondern in der Lage sein, selbst Anpassungen am System (Customizing) durchzuführen.
In der finalen Go-live-Phase geht ZetVisions SPoT an die Arbeit. Nach erfolgreichem Abschluss des Projekts erfolgt die Übergabe an unser Support-Team.
Wie sieht Ihr Schulungskonzept aus?
Wittigayer: Wir verfolgen von Projektbeginn an ein Train-the-Trainer-Konzept. Im Mittelpunkt steht dabei das Team, das in den ersten beiden Projektphasen das Customizing definiert und vollständigen Zugang zum System erhält.
Schon innerhalb einer Administratorschulung implementieren die Administratoren des Kunden mit unserer Unterstützung das System und können es selbstständig customizen.
Das heißt: Der Kunde kann auf die hauseigene SAP-Basisexpertise zugreifen, um z. B. das SPoT-Customizing und das Berechtigungsmanagement vorzunehmen.
Darüber hinaus werden in der zweiten Phase des Projekts weitere Schulungen zu einzelnen Aspekten des Systems durchgeführt.
Was ist das Ziel der Schulungen?
Wittigayer: Die Teilnehmer entwickeln während der Schulungen ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise von SPoT und machen erste Erfahrungen mit der Dateneingabe und -auswertung.
Ziel des Train-the-Trainer-Konzepts ist es, neben der Lösungseinführung den Projektmitarbeiter zu befähigen, eigenständig Schulungen zu leiten. Nach Projektabschluss können Kunden die Endanwender in einer nachgelagerten Schulungsphase in das System einführen.
Bei Bedarf bietet auch ZetVisions solche Anwenderschulungen zu den gewünschten Themen an oder unterstützt bei der Durchführung.
Was passiert nach der Implementierung bzw. nach dem Projekt?
Wittigayer: Natürlich bleiben wir auch nach der Einführung von ZetVisions SPoT an der Seite unserer Kunden.
Nach dem Go-live steht unser Support nicht nur während der Hypercare-Phase direkt nach Inbetriebnahme, sondern auch darüber hinaus für alle Fragen, Wünsche und Probleme zur Verfügung.
Die Intensität der Betreuung wird dabei allein durch die Anforderungen unserer Kunden bestimmt.
Was sind Ihre persönlichen „lessons learned“ aus Stammdatenprojekten?
Wittigayer: Neben der Beachtung der oben beschriebenen Erfolgsfaktoren kommt es darauf an, erst einmal die richtigen Fragen zu stellen. Das hat uns nicht nur die Erfahrung aus zahlreichen Kundenprojekten gezeigt, sondern auch die Implementierung unserer Lösung für Kundenstammdaten im eigenen Haus.
Die Ausgangssituation war gekennzeichnet durch drei verschiedene Datenpools, in denen die internen Abteilungen Kundendaten, wie beispielsweise Name, Adresse, Kontaktpersonen, für ihre Zwecke und damit mehrfach angelegt haben.
Informationen, die in einem „Datentopf“ ankamen, wurden nicht immer an die anderen weitergereicht, die sie aber auch hätten kennen müssen. Das klingt zunächst unspektakulär, ist aber leider der Nukleus für die typischen, generalisierbaren Probleme beim Management von Stammdaten.
Wie gelingt die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungsgrenzen hinweg?
Wittigayer: Zunächst mussten sich die Fachbereiche über die Definition austauschen und während des Projekts ein einheitliches Wording festlegen.
Zum Beispiel sprach die Finanzabteilung von „Debitoren, Kunden“, wohingegen Sales & Marketing von „Accounts“ sprachen.
Allein die Frage „Wann ist jemand Kunde?“ hat einige Diskussionen ausgelöst.
Vor diesem durchaus verallgemeinerungsfähigen Hintergrund gehören zu den typischen Fragen, die sich vor und während eines Stammdatenprojekts stellen:
- Was bedeuten Stammdaten in unserem Kontext?
- Wie werden diese Stammdaten definiert?
- Welche Stammdaten müssen angeglichen, welche sollen überhaupt initial übernommen werden?
- Was sind globale oder lokale Stammdaten?
- Welches System hat die beste Datenqualität für die initiale Datenübernahme in ZetVisions SPoT?
- Welche Überschneidungen dieser Stammdaten mit den bestehenden Datenpools gibt es?
- Was sind die technischen Besonderheiten der Systeme?
- Wie soll der Soll-Prozess aussehen?
- Wer ist für Dateneingabe und -pflege verantwortlich?
- Wie sollen die Freigabeprozesse aufgebaut sein?
- Welche Systeme sollen angebunden werden?
Im Ergebnis führt die Beantwortung dieser Fragen im Wege der Implementierung einer Stammdatenmanagement-Lösung zu einer deutlich besseren Data Governance durch klar definierte Verantwortlichkeiten und kontrollierte Prozesse für Dateneingabe und -freigabe sowie kontrollierte und zentralisierte Datenverteilung an alle Empfängersysteme.
Wie wirkt sich das auf die Fehlerquellen aus?
Wittigayer: Potenzielle Fehlerquellen werden reduziert, weil definiert ist, wer welche Informationen wo pflegen – oder eben nicht pflegen – darf.
Da alle Systeme dieselbe Version der Stammdaten nutzen, wird die Datenqualität „automatisch“ besser, die richtigen Daten liegen stets tagesaktuell vor.
Schlanke Prozesse ohne redundante, manuelle Dateneingabe in den verschiedenen Systemen – und dem damit verbundenen Abstimmungsaufwand zwischen den Abteilungen – reduzieren Komplexität und Kosten.
Dieses Resümee lässt sich auf jedes andere Stammdatenmanagement-Thema übertragen.
Danke für das Gespräch!